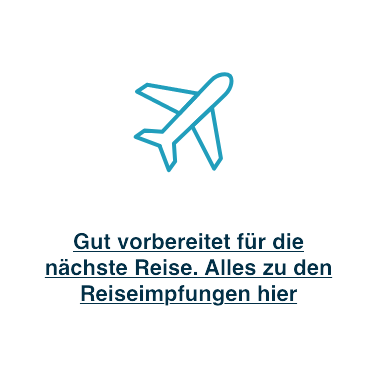Willkommen auf unserem Portal zum Thema Impfen
In einer Welt, die ständig von neuen Krankheiten und Viren bedroht wird, ist das Thema Impfen von größter Bedeutung. Impfungen haben einen enormen Einfluss auf die öffentliche Gesundheit und sind eine der effektivsten Maßnahmen zur Verhinderung von Krankheiten und zum Schutz der Bevölkerung.
Unser Portal widmet sich dem Thema Impfen und bietet einen Überblick über die Impfempfehlungen für verschiedene Altersgruppen sowie Informationen über verschiedene Impfstoffe, deren Wirkungsweise und Sicherheit. Unser Ziel ist es, eine vertrauenswürdige und leicht zugängliche Quelle für alle Fragen im Zusammenhang mit Impfungen zu sein.

Die ersten Immunisierungen Ihres Kindes
Erfahren Sie, welche Impfungen Ihr Kind in den ersten Jahren empfohlen sind und welche später aufgefrischt werden sollten.
Erwachsene sollten an ihren Impfschutz denken
Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen brauchen zusätzliche Impfungen. Aber auch als gesunder Erwachsener sollten Sie regelmäßig einen Blick in Ihren Impfpass werfen, um keine Auffrischimpfung zu verpassen.


Welche Impfungen im Jugendalter?
Bei Jugendlichen ist es wichtig, den Impfschutz gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten (Pertussis) und Kinderlähmung (Poliomyelitis) aufzufrischen und eine Immunität gegen humane Papillomviren (HPV) aufzubauen.
Impf-Fakten in 17 Sprachen
Medizinische Zusammenhänge sind nicht immer leicht zu erfassen, besonders dann, wenn Sprachbarrieren existieren. Laiengerecht aufbereitete Informationen in 17 Sprachen versorgen Eltern unterschiedlichster Nationalitäten mit den wichtigsten Fakten rund um das Thema Impfen – von Albanisch bis Vietnamesisch.

Erster RSV-Schutz für alle Säuglinge zugelassen
Nahezu alle Kleinkinder infizieren sich mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bevor sie 2 Jahre alt sind. Das RS-Virus ist eine der Hauptursachen für Krankenhausaufenthalten bei Säuglingen und kann zu einer Bronchiolitis oder Lungenentzündung führen.
Seit September ist ein Schutz für alle Säuglinge verfügbar.

An Grippeschutz gedacht?
Die Impfung gegen Grippe schützt vor der „echten“ Grippe. Doch was unterscheidet eine Grippe von einer Erkältung? Und für welche Personen wird eine Grippe-Impfung empfohlen?
MAT-DE-2303775-1.0-09/2023
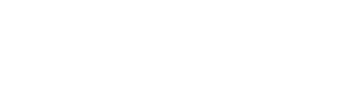
Copyright © 2023 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Seite richtet sich an Interessenten aus Deutschland.
Für unsere Webseiten wurden Bilder von iStockphoto.com, Fotolia.de, gettyimages.de, pexels.com und photocase.de verwendet.