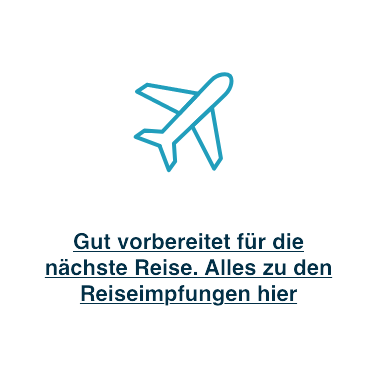Impfungen schützen insbesondere die Kleinsten
Babys und Kleinkinder sind besonders anfällig für Infektionen, da ihr Immunsystem sich noch im Aufbau befindet.1,2 Daher empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) frühzeitige Schutzimpfungen – für einen gesunden Start ins Leben.3
Was schützt mein Kind vor gefährlichen Viren?
Neben bewährten Standardimpfungen gibt es mittlerweile auch eine passive Immunisierung gegen RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus).3 RSV kann bei Säuglingen schwere Atemwegserkrankungen verursachen.4 Eine Immunisierung schützt besonders in den ersten Lebensmonaten, in denen das kindliche Immunsystem noch nicht vollständig entwickelt ist.1,2

Bestmöglicher Immunschutz – von Anfang an
Als fürsorgliche Eltern möchten Sie Ihrem Kind alles geben, was es für einen gesunden Start ins Leben benötigt. Dazu gehört auch ein wirksamer Schutz vor den sogenannten „Kinderkrankheiten“. Was sich harmlos anhört, kann gravierende Folgen für die Gesundheit haben.
Die einzige Möglichkeit, Ihr Kind und auch sich selbst bestmöglich zu schützen, sind zeitgerechte Impfungen. So können Sie dafür sorgen, dass durch Impfungen vermeidbare Krankheiten gar nicht erst ausbrechen – für einen umfassenden Schutz von Anfang an.
Impfungen während der U-Untersuchungen
Die Impfungen erfolgen meist im Rahmen der sogenannten U-Untersuchungen (U3 bis U6). Nutzen Sie die Termine, um gemeinsam mit Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt den Impfstatus Ihres Kindes zu besprechen.5
Die STIKO* empfiehlt für alle Neugeborene,
Säuglinge und Kleinkinder Impfungen gegen:3
- Windpocken (Varizellen)
- Masern, Mumps und Röteln (MMR)
- Pneumokokken
- Meningokokken der Serogruppe B und C
- Rotaviren
- RSV (Respiratirisches Synzytial-Virus
Der aktuelle Impfkalender der STIKO* informiert Sie über die aktuell empfohlenen Standardimpfungen und darüber, wann Sie oder Ihr Kind diese brauchen.
Sehen Sie, warum die Impfung gegen Keuchhusten wichtig ist: Jarrods Kampf um das Leben
RSV kann jeden treffen, aber jeden trifft es anders.
Familien, die einen schweren RSV-Verlauf eines Säuglings mitgemacht haben, teilen hier ihre eigene Geschichte. Diese emotionalen Geschichten geben einen Einblick, wie RSV das ganze Leben durcheinander bringen kann.
Unsere Broschüren in unserer Mediathek helfen Ihnen als Wegweiser im Dschungel an Informationen:

Impfungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Nicht nur Kinder erkranken an „Kinderkrankheiten“, sondern auch Jugendliche und Erwachsene – oftmals sogar schwerwiegend.
Die aktuelle Impfbroschüre von Sanofi gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema Impfung.
Impf-Fakten in 17 Sprachen
Medizinische Zusammenhänge sind nicht immer leicht zu erfassen, besonders dann, wenn Sprachbarrieren existieren. Laiengerecht aufbereitete Informationen in 17 Sprachen versorgen Eltern unterschiedlichster Nationalitäten mit den wichtigsten Fakten rund um das Thema Impfen – von Albanisch bis Vietnamesisch.
Bei der Tagesmutter und in der Kita: Masernimpfpflicht
Ihr Kind wird bei der Tagesmutter oder in der Kita betreut? Dann sollten Sie die empfohlenen Zeiten für die Masernimpfung unbedingt einhalten. Lesen Sie, für wen die Impfpflicht gilt und wann geimpft wird.

Erster RSV-Schutz für alle Säuglinge verfügbar
Nahezu alle Kleinkinder infizieren sich mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bevor sie 2 Jahre alt sind. Das RS-Virus ist eine der Hauptursachen für Krankenhausaufenthalten bei Säuglingen und kann zu einer Bronchiolitis oder Lungenentzündung führen.
Seit September 2024 ist ein Schutz für alle Säuglinge verfügbar.
Erster Nestschutz durch Impfungen während der Schwangerschaft
Beim Neugeborenen ist das Immunsystem noch nicht vollständig ausgebildet. Die beim Stillen von der Mutter zum Kind übertragenen Antikörper unterstützen das Immunsystem des Babys, doch dieser Schutz ist nicht von Dauer.
* Die Ständige Impfkommission (STIKO) ist ein unabhängiges Expertengremium am Robert Koch-Institut in Berlin, das auf Veranlassung des Bundesgesundheitsministeriums die aktuellen Impfempfehlungen erarbeitet
1. Albrecht M et al. Vaccine. 2022; 40(11): 1563–157.
2. Robert Koch-Institut (RKI). Impfmythen: Falschinformationen wirksam aufklären. https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Informationsmaterialien/Impfmythen/falschinformationen-wirksam-aufklaeren-node.html Stand: Feb. 2024. Abgerufen am 28.05.2025.
3. Robert Koch-Institut (RKI). Epid Bull. 2025; 4: 1–75.
4. Robert Koch-Institut. Respiratorische Synzytial-Virus-Infektionen (RSV). https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_RSV.html. Stand: Mai 2025. Abgerufen am 28.05.2025.
5. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Kindergesundheit. Früherkennung U1-U9 und J1. https://www.kindergesundheit-info.de/themen/frueherkennung-u1-u9-und-j1/untersuchungstermine/ Stand: Sep. 2024. Abgerufen am 28.05.2025.
MAT-DE-2303610-2.0-08/2025
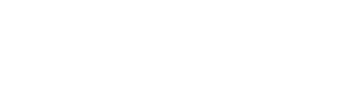
Copyright © 2025 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Seite richtet sich an Interessenten aus Deutschland.
Für unsere Webseiten wurden Bilder von iStockphoto.com, Fotolia.de, gettyimages.de, pexels.com und photocase.de verwendet.